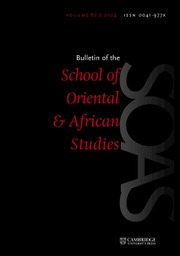Abraham Drewes und Roger Schneider publizierten 1991 den ersten von bisher zwei Bänden des Recueil des inscriptions de l'Éthiopie des périodes pré-axoumite et axoumite (RIÉ), das seither eine feste Größe innerhalb der Äthiopistik geworden ist. Zwar erschien im Jahre 2000 ein Übersetzungsband mit Kommentar zu den griechischen Inschriften aus der Feder von E. Bernard (RIÈ III.A), die lang ersehnte Bearbeitung der äthiosemitischen Inschriften ließ jedoch auf sich warten. Nach dem Tod Schneiders im April 2002 entschied sich Drewes, die Arbeiten alleine fortzuführen, er verstarb jedoch selbst 2007. Manfred Kropp und Harry Stroomer ist es zu verdanken, dass das fast fertige Werk nun doch in gedruckter Form vorliegt. Der Erstgenannte hat die undankbare, aber umso verdienstvollere Aufgabe übernommen, das nachgelassene Manuskript zu überarbeiten und zu redigieren. Damit hat endlich dem Nicht-Spezialisten für altäthiopische Epigraphik ein Hilfsmittel zur Hand, das die meisten wichtigen Schriftquellen zur aksumitischen Geschichte erschließt. Es kann wohl kaum stark genug betont werden, wie bedeutsam diese »Geburtshilfe« war und daher soll zunächst einmal Herrn Kropp für diese Arbeit ein ganz besonderer Dank ausgesprochen werden.
Nun zum Werk selbst. Die Anlage und Gliederung desselben war selbstverständlich durch die vorausgehenden Bände vorgegeben, d.h. die Inschriften werden chronologisch und räumlich sowie nach Schriftträger geordnet behandelt: in Teil 1 die prä-aksumitischen Inschriften, in Teil 2 die aksumitischen. Teil 3 präsentiert beschriftete Kleinfunde wie Siegel, Teil 4 beschriftete Keramik und Teil 5 Monogramme. Abgerundet wird dieser Kommentarteil durch mehrere Präliminarien zu Beginn und mehreren Indices (Teil 7) sowie eine Bibliographie (Teil 8).
In einer Einleitung von Roger Schneider wird näher begründet, weswegen bestimmte Inschriften nicht in das RIÉ aufgenommen wurden und sogar eine kleine Liste gibt (S. 6–7). An diese schließt sich eine weitere Liste an, die seit dem Erscheinen der ersten beiden Bände des RIÉ (1991) publizierte Inschriften aufführt (S. 7–15), wobei den britischen Grabungen in Aksum und den Prospektionen von V. Franchini besondere Abschnitte gewidmet sind. Nicht nur zwischen den Zeilen erfährt man also, dass auch an dem nun vorgelegten Band Roger Schneider einen wahrscheinlich viel größeren Anteil hat, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. So erfahren wird, dass es eine gemeinsame provisorische Übersetzung der Inschriften gab und Schneider das Manuskript mehrfach gelesen und kommentiert hat. Wir sind also in der sehr eigenartigen Lage, dass wir hier ein Buch vor uns haben, bei dem wir überhaupt nicht abschätzen können, was genau von wem stammt – Kropps Anteil ist womöglich eher gering und Schneiders wahrscheinlich immens, nur dass Letzterer in der Titelei nicht erwähnt wird. Schneiders Anteil wird schon allein an der Sprache deutlich, denn das Buch wurde auf Französisch verfasst.
Drei Aspekte des vorliegenden Bandes stechen heraus. Zum ersten sind es die ausführlichen und hervorragenden Indices. Zum zweiten ist es der Umstand, dass neun besonders diskutierte Fragestellungen in Form von Einzelstudien als Teil 6 extra behandelt wurden. Und schließlich ist besonders hervorzuheben, dass hier große Mühe verwendet wurde, das gesamte onomastische Material des Corpus’ aufzubereiten, also alle in den Inschriften genannten Orts-, Personen-, Götter- und Völkernamen einer Untersuchung zu unterziehen. Im Ganzen erschließen vier Indices den epigraphischen Bestand: jeweils ein Lexikon der vorkommenden Wörter und ein onomastischer Index für die äthiopischen Inschriften aus aksumitischer Zeit und für die äthiosabäischen Inschriften aus prä-aksumitischer Zeit. Ebenfalls sehr vorteilhaft ist der Umstand, dass im Lexikon nicht einfach nur die Belegstellen gegeben werden, sondern auch der unmittelbare Kontext derselben, also die Einbettung der Lexeme in ihren syntaktischen Zusammenhang. Die zweite Studie in Kapitel 6 behandelt zudem die in den Feldzugsberichten aufgeführten Namen von Truppenteilen ausführlicher.
Drewes schriebt in seinem Vorwort (S. 4), er habe die seit 1995 erschienene Forschungsliteratur mit Ausnahme der in Rassegna di Studi Etiopici und Aethiopica publizierten Artikel nicht mehr systematisch berücksichtigen können. Wir haben es also mit einem Buch zu tun, das grundsätzlich den Forschungsstand vor einem Vierteljahrhundert wiederspiegelt. Dies soll selbstverständlich kein Vorwurf sein – lediglich eine Feststellung, die für Forscher aus Nachbardisziplinen nicht unerheblich sein dürfte.
Der springende Punkt ist nämlich, dass sich die Forschungslage zur äthiosemitischen Epigraphik seither fundamental verändert hat. Zum einen sind mit der Encyclopaedia Aethiopica und dem dreibändigen Werk In kaiserlichem Auftrag. Die Deutsche Aksum-Expedition 1906 unter Enno Littmann (herausgegeben von S. Wenig) zwei Werke erschienen, die in vielen Bereichen Synthesen der bisherigen epigraphischen Arbeiten erbracht haben. Hinzu kommt, dass seit 2014 eine neue Monographiereihe Studien zum Horn von Afrika existiert (Köppe Verlag, Köln).
Zum anderen sind zahlreiche Inschriften neu bearbeitet worden. Genannt seien insbesondere RIÉ 14, 118, 185–95, 218, 223, 232, 239, 263–6 und 267. Nur am Rande sei erwähnt, dass man das äthiopische Grafitto von Meroe zwar im RIÉ findet, nicht jedoch dasjenige von Kawa (C. Rabin, Old Abyssinian(?) graffito, in M.F.L. MacAdam, The Temples of Kawa I, London 1949, 117–8).
Die meiste Literatur zu diesen Texten sowie zu allgemeineren linguistischen Erforschung der altabessinischen Inschriften lässt sich über mein Buch Das Königreich Aksum. Geschichte und Archäologie Abessiniens in der Spätantike (Darmstadt, 2012) oder den bereits genannten Überblickswerken erschließen. Weitere Literatur findet sich versammelt in den Arbeiten von George Hatke (Africans in Arabia Felix, PhD Dissertation, Princeton, 2011), N. Nebes (Könige der Weihrauchstraße, Göttingen, 2014) und C. Hofmann (Ethnizität und Ethnogenese am Horn von Afrika nach den Inschriften von König ‘Ezānā, in H. Elliesie (Hrsg.), Multidisciplinary Views on the Horn of Africa, Köln, 2014, 217–51.). Leider war der Aufsatz von S. Weninger (A hundred years of Aksumite epigraphy since Enno Littmann, in W. Muluwork Kidanemariam und W.G.C. Smidt (Hrsg.), Regional History and Culture of the Horn, Mekelle, 2016, 93–102) ebenfalls fast ein Jahrzehnt im Druck und ist damit nicht ganz auf dem neuesten Stand.
Zum dritten hat sich durch die Neufunde von Wuqro eine ganz neue Perspektive für die Erforschung der frühen äthiosemitischen Schriftzeugnisse ergeben (N. Nebes, Die Inschriften aus dem ‘Almaqah-Tempel in ‘Addi’ Akadwǝḥ (Tigray), in Zeitschrift für Orient-Archäologie 3, 2010, 214–37; Nebes, Die Altarinschrift von Wuqro, Archäologie Weltweit 2, 2018, 36–7). Galt früher eine angebliche »sabäische Kolonisation« als ein möglicher Ursprung der aksumitischen Kultur, ist heute ziemlich deutlich, dass dies eine aus dem europäischen Kolonialismus erwachsene verzerrende These darstellt.
Und schließlich hat sich – weitgehend unbemerkt von weiten Teilen der äthiopistischen Forschung – in einem emminent wichtigen Bereich eine stille Revolution vollzogen: in der aksumitischen Numismatik. Angesichts der Abhängigkeit jeder aksumitischen Chronologie von den numismatischen Anreihungskriterien ist es unverständlich, dass im RIÉ zwar beschriftete Keramik aufgenommen wurde, nicht jedoch die Münzlegenden. Nun hat Wolfgang Hahn (Abfolge und Chronologie der spätaksumitischen Münzprägung, Mitteilungsblatt des Instituts für Numismatik und Geldgeschichte 41, 2011, 9–24) vor allem die spätaktumitischen Münzen einer erneuten Studie unterzogen und die Reihenfolge der Könige neu und vor allem anders rekonstruiert.