Die in ihrer Einleitung ausdrücklich als Gleichnis vom Himmelreich deklarierte Erzählung von den Arbeitern im Weinberg (Mt 20,1–16) hat ihren Platz im Matthäusevangelium in der ungefähr drei Kapitel umfassenden Erzähleinheit vom ‚Leben und Handeln der Jünger im Lichte des Königtums Gottes‘ (17,24–20,16).Footnote 2 Dort ist sie Teil einer Unterredung Jesu mit seinen Jüngern, welche von der Frage eines reichen Jünglings in 19,16: τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα σχῶ ζωὴν αἰώνιον angestoßen wurde.Footnote 3 Die Auseinandersetzung mit der Frage nach dem endzeitlichen ErgehenFootnote 4 nimmt in Mt 19,16–20,16 allein unter quantitativem Betrachtungswinkel einen beachtlichen Platz ein und bestimmt von daher das inhaltliche Profil dieser Erzähleinheit nicht unwesentlich mit. Allerdings bereitet das Nachzeichnen der Konturen dieses Profils dadurch Probleme, dass sich das Weinberggleichnis als markanter AbschlussFootnote 5 von Mt 19,16–20,16Footnote 6 gegen eine eindimensionale Funktionszuschreibung sperrt, selbst bei einer vorläufigen Hintanstellung von Erwägungen zu dessen möglichen sozialethischen Implikationen.Footnote 7
Für Friedrich Avemarie ist das Gleichnis durch die beiden Rangumkehraussagen in Mt 19,30 und 20,16 zu einem „Lehrstück über den Lohn der Nachfolge“ geworden, durch dessen gezielte Leserlenkung die angesprochenen Jünger zu einer Identifikation mit den Ganztagsarbeitern herausgefordert werden. Wie diese bringen sie „die größten persönlichen Opfer“ und laufen Gefahr, sich von daher Hoffnung auf Ehrenplätze zu machen bzw. „sich über später Gekommene zu überheben, statt sie als gleichgestellt zu akzeptieren“.Footnote 8 Margaret Hannan erscheint das Gleichnis aufgrund der engen Vernetzung mit 19,27–9 als „veiled warning against any assumption on the part of the disciples that the rewards promised in 19.28–9 are theirs by right“.Footnote 9 Noch einen Schritt weiter geht Gerd Häfner und sieht den Gedanken der endzeitlichen Gefährdung der Jünger „deutlich profiliert“. Dabei fasst er das Umkehrungsschema als „Warnung vor der Illusion endzeitlicher Garantien“ auf.Footnote 10 Er erwägt aber auch, dass damit im Kontext der Selbstauskunft des Petrus in 19,27 eine Entlastung dahingehend eingebracht ist, „dass es nicht auf Höchstleistungen wie die des Petrus“ ankommt, sondern „auch geringerer Einsatz belohnt“ wird.Footnote 11 Folgt man dieser Spur, umfasst Mt 19,30–20,16 neben dem Moment der Mahnung im Hinblick auf das endzeitliche Ergehen und damit verbundener etwaiger falscher Sicherheiten auch „die Dimension des Zuspruchs“.Footnote 12 Auf eine weitere mahnende Dimension verweist Matthias Konradt, dem zufolge mit dem Erzählen des Gleichnisses „das gegenwärtige Geltendmachen von besonderen Statuspositionen in der Gemeinde unterlaufen“ wird, was dem Gleichnis „innerekklesial eine eminent kritische Stoßrichtung“Footnote 13 verleiht.Footnote 14
So vielgestaltig und differenziert die Funktionsbestimmungen auch ausfallen,Footnote 15 so fällt doch auf, dass trotz dieser Vielstimmigkeit kaum gezielt nach dem Beitrag gefragt wird, den dieses Himmelreich-Gleichnis zur erzählerischen Entfaltung der matthäischen Basileiakonzeption leistet.Footnote 16 Erste Vorstöße in diese Richtung sind jenen Interpretationen zu entnehmen, in welchen das Gleichnis über seine unmittelbare Rahmung durch die Rangumkehraussagen in Mt 19,30 und 20,16 hinaus etwa im Umfeld der Thronverheißung in 19,28Footnote 17 oder im Horizont des Gesprächs mit den Zebedaiden und deren MutterFootnote 18 und den anschließenden Ausführungen Jesu zu der von ihm geforderten Art und Weise der HerrschaftsausübungFootnote 19 diskutiert wird.Footnote 20 Methodisch treffen sich diese unterschiedlichen Vorstöße alle in dem Punkt, dass teilweise gattungsbedingtFootnote 21 die Einbeziehung der kontextuellen Vernetzung zumeist stichprobenartig erfolgt,Footnote 22 ohne eingehend die Entfaltung der Basileiathematik im Makroabschnitt in Mt 17,24–20,16 in den Blick zu nehmen, insbesondere im dortigen Ringen des Erzählers um eine sachgemäße Zuordnung von göttlichem und menschlichem Handeln beim Gewinnen des Himmelreiches.
Mit meinen Überlegungen möchte ich helfen, diese Forschungslücke dadurch zu schließen, dass ich die erzählerische Entfaltung der Basileiakonzeption in diesen drei Kapiteln nachzeichneFootnote 23 und im Zuge dieser Analyse einen präzisen Einblick in die erzählstrategische Platzierung des Himmelreichgleichnisses von den Arbeitern im Weinberg zu gewinnen suche. Angesichts der Tatsache, dass diese KapitelFootnote 24 von einem engmaschigen Netz von basileiatheologischen und basileiachristologischen Aussagen durchzogen sind, verspricht eine an dieser quellentextlichen Vorgabe orientiere thematische Ausrichtung meiner Überlegungen nicht nur einen tieferen Einblick in einen Teilbereich der matthäischen Basileialinie. Zugleich kann eine solche Ausrichtung auch eine tragfähige und detaillierte Vorstellung von der materialen Ausgestaltung einer zentralen Facette des inhaltlichen Profils der matthäischen Erzählung vom Weg Jesu nach Jerusalem insgesamt vermitteln.
1. Ein Vorbereitungsschritt zur Textabgrenzung
Eine erste Antwort auf die Frage nach der Abgrenzung des Makroabschnittes, zu welchem das Weinberggleichnis gehört, lässt sich durch die Beobachtung gewinnen, dass die Erzählung von Jesu Weg nach Jerusalem in Mt 16,21–20,34 durch den Einsatz der drei Leidensankündigungen maßgeblich strukturiert ist.Footnote 25 Dementsprechend haben sich meine Überlegungen schwerpunktmäßig auf die Analyse jener Basileiaaussagen zu konzentrieren, die zwischen der zweiten und dritten Leidensankündigung, d.h. in Mt 17,24–20,16 platziert sind.Footnote 26 Eine durchgängige Beschäftigung mit ethischen Aspekten aus dem Leben der Jünger verleiht diesem Abschnitt mit dem Weinberggleichnis als Schlusspunkt eine thematische Kohärenz. Erzählextern spricht für die Abgrenzung dieser Erzähleinheit eine redaktionskritische Beobachtung.Footnote 27 Obschon Matthäus sich in der Anlage seiner Erzählung von Jesu Weg nach Jerusalem insgesamt eng an der Perikopenfolge der Markusvorlage orientiert, verleiht er der Erzähleinheit in Mt 17,24–20,16 durch die Einfügung der Sonderguttexte in Mt 17,24–27 und 20,1–16 sowie des Ausbaus von Mk 9,33–47 zu einer umfänglichen Rede über das Gemeinschaftsleben ein sehr eigenes Profil.
Obgleich auf dem Hintergrund dieser Entscheidung zur Textgliederung das Hauptaugenmerk meiner Überlegungen auf der Analyse der innerhalb von Mt 17,24–20,16 platzierten Basileiaaussagen liegen wird, ist ferner noch die christologische Basileiaaussage aus Mt 20,21 zu berücksichtigen. Mit deren ergänzender Einbeziehung wird der Tatsache Rechnung getragen, dass die in der Literatur zu findenden Verweise auf erzählinterne Querverbindungen des Weinberggleichnisses nicht selten auf eben diese Aussage und die zugehörige Replik Jesu rekurrieren.Footnote 28 Darüber hinaus hält die Einbeziehung von 20,21–3 im Bewusstsein, dass Abschnittsabgrenzungen wie hier die Abhebung von 17,24–20,16 immer eine Frage der Interpretation darstellen.Footnote 29 Dabei dient die Abgrenzung hier dazu, aus dem Kontinuum der Gesamterzählung ein bestimmtes Textsegment begründbar als Materialbasis für die Analyse eines sinnvollen Ausschnittes aus der erzählerischen Entfaltung der Basileiakonzeption zu erhalten. Zugleich bewahrt das Wissen um andere Gliederungsvorschläge davor,Footnote 30 bei aller notwendigen Konzentration auf ein bestimmtes Teilstück dieses zu scharf aus der Gesamterzählung zu isolieren.Footnote 31
2. Ein Überblick über die erzählerische Entfaltung der Basileiathematik in Mt 17,24–20,16
Bei der folgenden tabellarischen Aufstellung der zehn Basileiaaussagen in Mt 17,24–20,16 (+ 20,21), zu denen noch die Thronverheißung in Mt 19,28 hinzuzunehmen ist,Footnote 32 finden sich neben Angaben zur Stelle und dem Wortlaut der jeweiligen Aussage auch Eintragungen zur Textgliederung, um so von Beginn an ein möglichst detailliertes Bild von der Verteilung der Einzelaussagen über den Gesamtausschnitt zu erhalten.
Schon durch Beachtung der Wechsel in der figural-situativen Ausgestaltung der Szenerie lässt sich die Erzähleinheit in Mt 17,24–20,16 in fünf Unterabschnitte einteilen. Dabei folgt auf eine erste Einheit zur Tempelsteuer in 17,24–27 die ausführliche Darbietung der Gemeinderede Jesu in 18,1–35. An die Aufbruchsnotiz in 19,1 schließen sich Ausführungen zu Ehe, Ehescheidung und Ehelosigkeit an (19,2–12), bevor Matthäus die kurze Erzählung von der Segnung der Kinder in 19,13–15 präsentiert. Im Anschluss daran tritt ein reicher Jüngling in Erscheinung und leitet mit seiner Frage nach den Bedingungen für das Erlangen des ewigen Lebens in 19,16 einen umfangreichen Abschnitt der Wegerzählung ein, der sich auf einer nachgeordneten Gliederungsebene in die Untereinheiten 19,16–26 und 19,27–20,16 unterteilen lässt. In diesen beiden Abschnitten thematisiert Jesus sowohl den Reichtum als Gefahr für das Heil als auch den Lohn der Nachfolge und illustriert diesen Lohngedanken im Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg (19,16–20,16).
Überblickt man unter besonderer Berücksichtigung der Daten aus Spalte 3 (siehe Tabelle 1) die Verteilung der Aussagen über Mt 17–20, lässt sich die eingangs aufgestellte These bezüglich der engmaschigen Verteilung der Basileiaaussagen noch entscheidend präzisieren. Beim Abgleich mit den Beobachtungen zur Textkomposition zeigt sich nämlich, dass in einer Vielzahl der Einzelabschnitte mit Ausnahme der eröffnenden Erzähleinheit zum Umgang mit der TempelsteuerFootnote 33 zumindest eine basileiatheologische bzw. basileiachristologische Aussage auftaucht. Wie ein roter Faden durchzieht die Basileiathematik die Erzähleinheit Mt 17,24–20,16Footnote 34 und verbindet deren einzelne Unterabschnitte über alle figuralen und räumlichen Wechsel hinweg fest miteinander. Damit wird über die verschiedenen Ortswechsel hinausFootnote 35 und angesichts der auf Jerusalem massiv zudrängenden Erzähldynamik zur Geltung gebracht, dass auch die dort stattfindenden Ereignisse unter dem in 4,17 gesetzten programmatischen Vorzeichen stehen: Es ist und bleibt trotz aller bevorstehenden scheinbaren Rückschläge in JerusalemFootnote 36 die Zeit, in welcher das Himmelreich nahe herangekommen ist; Gott ist dabei, allen Widerständen zum Trotz seine im Himmel ohnehin bestehende Herrschaft auch auf Erden aufzurichten.
Tabelle 1. Die Basileiaaussagen und deren Verortung.
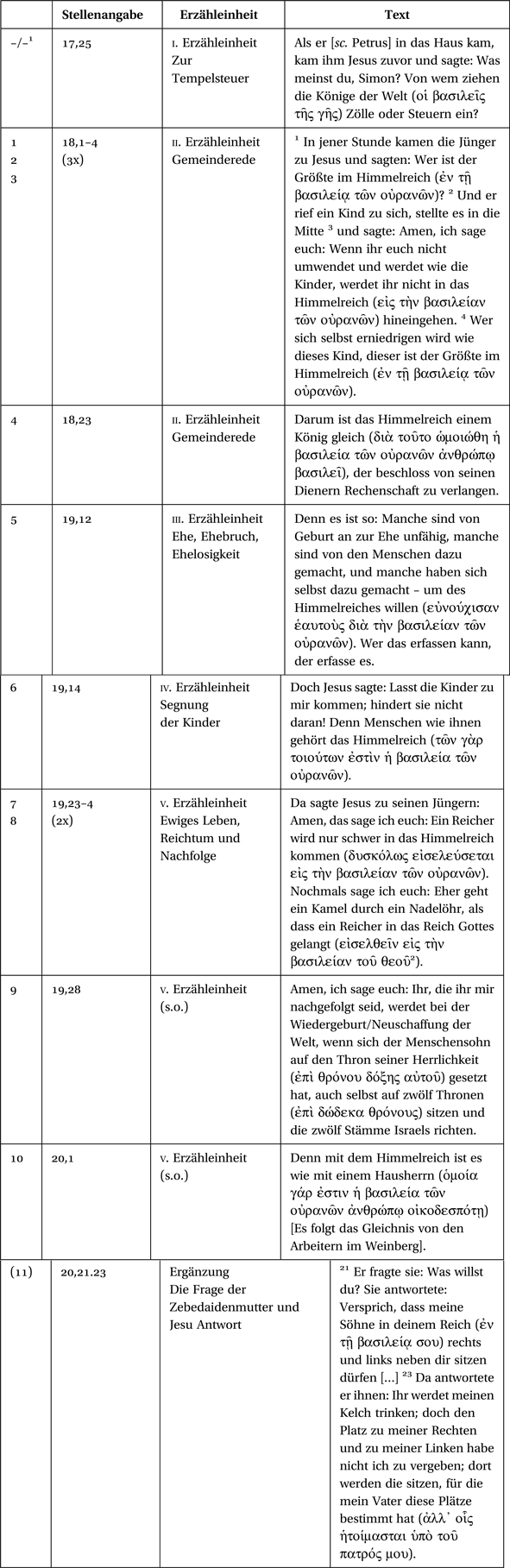
1 Die Eintragung dieser ‚Basileiaaussage’ bleibt ohne Zuweisung einer laufenden Nummer, da sie weder theologisch noch christologisch gefasst ist; wenn sie dennoch hier aufgeführt und am Ende von Abschnitt 3 in die Überlegungen einbezogen wird, soll damit im Bewusstsein gehalten werden, dass der Erzähler seine theologische Basileiakonzeption nicht in einem abstrakten-luftleeren Raum entfaltet, sondern auch in Abgrenzung zu realweltlich erfahrbaren, irdischen Königreichen und deren Machtstrukturen (siehe etwa 20,25–7).
2 Siehe zur textkritischen Diskussion von Mt 19,24 nur J. O'Callaghan, „Examen critico de Mt 19,24“, Bib. 69 (1988) 404–5.
(1–4) Geht man im Wissen um dieses engmaschige Verteilungsmuster mit dessen kontinuitätsstiftender Funktion zur Betrachtung der Einzelaussagen über, wird man Zeuge, wie Jesus am Beginn der Gemeinderede in 18,1–5 Zugangsbedingungen zum Heilsraum der βασιλεία τῶν οὐρανῶν auslotet und wesentliche Eckpunkte der Werteskala dieses Herrschaftsbereiches umreißt. Angestoßen von der Jüngerfrage nach dem Größten im Himmelreich ruft er ein Kind zu sich und definiert wohl in Anbetracht von dessen „niedrige[m] Status in der antiken Gesellschaft“,Footnote 37 dass man nur durch eine Umwendung hin zu einem solchen Status ins Himmelreich gelangen kann.Footnote 38 Den in der Benennung dieses Zugangskriteriums schon mitschwingenden Kontrast zu den innerweltlichen Wert- und Herrschaftsvorstellungen hebt Jesus in V. 4 ausdrücklich ins Wort. Dabei geht er soweit, dass er in völliger Umwertung dieser irdischen Vorstellungen denjenigen als den Größten im Himmelreich ausweist, der bereit ist, die eigene Niedrigkeit vergleichbar den Kindern aktiv anzunehmen (ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο). Betrachtet man diese Niedrigkeitsforderung in ihrem erzählerischen Kontext, d.h. im Horizont der vorausgehenden Leidensankündigung und im Wissen um den tödlichen Ausgang des Weges nach Jerusalem, gewinnt man den Eindruck, dass diese Forderung an die Gemeinde ihre Wurzel in der Handlungsvorgabe Jesu selbst hat: So wie er seinen Weg zu seinem Leiden in Niedrigkeit gegangen ist und auch bei seiner Kreuzigung auf jede Form von irdischer Machtdemonstration verzichtet hat, so sind die Menschen in seiner Nachfolge gefordert, diese Handlungsweise durch die aktive Annahme der eigenen Niedrigkeit konsequent nachzuahmen. Damit können sie einen Beitrag zur Durchbrechung und Relativierung der irdischen Macht- und Wertvorstellungen leisten und so ansatzweise die irdische Wirklichkeit in Richtung der Realität des Himmelreiches verändern.
Nach diesem ausgeprägten basileiatheologischen Aufschlag am Beginn der Gemeinderede greift Jesus die Himmelreichthematik einige Verse später zur Beantwortung der von Petrus gestellten Frage, wie oft er vergeben müsse, erneut auf, diesmal in Form eines Himmelreichgleichnisses (Mt 18,23–35). In dessen Einleitung erzählt er von der Absicht eines Königs, mit den Dienern Abrechnung zu halten. Allein durch die Zuschreibung dieser Handlung wird der König als der maßgebliche Souverän seines Reiches – im übertragenen Sinne: Gott als Souverän des Himmelreiches – erwiesen. Dabei wird dieser Gott-König im Erzählverlauf des Gleichnisses als Figur profiliert, die dem um einen Schuldenerlass bittenden Diener Erbarmen gewährt, eine Nachahmung dieses Verhaltens auf zwischenmenschlicher Ebene erwartetFootnote 39 und bei Nichterfüllung dieser Erwartung strafend einzugreifen imstande ist. Durch den abschließenden Hinweis auf die wohl ewig andauernde Bestrafung des beschenkten, aber selbst nicht zum Schenken bereiten Dieners und die explizite Übertragung auf die Handlungsweise des ‚himmlischen Vaters’ wird die Forderung zur Imitatio Dei im Bereich des zwischenmenschlichen Erbarmenserweises nachdrücklich eingeschärft. Zugleich wird auf die extremen soteriologischen Negativfolgen einer Nichtbeachtung verwiesen. Wie schon bei der Niedrigkeitsforderung am Beginn der Gemeinderede so steht auch hier der Gedanke im Hintergrund, dass die Menschen in der Jesusnachfolge sich bei den von ihnen erwarteten Handlungen an der Handlungsweise Jesu bzw. Gottes orientieren können, d.h. ein konkretes Handlungsvorbild haben (Nachahmung). Darüber hinaus darf trotz aller Massivität des Anspruches zur Imitatio Dei nicht die grundlegende Dimension der sämtlichen Forderungen vorausgehenden Berufung aus dem Blick verloren werden: In der matthäischen Konzeption sind die Menschen in der Jesusnachfolge nicht nur zur Nachahmung göttlicher Handlungsweisen unbedingt gefordert, ihnen ist aufgrund ihrer Berufung eine solche Handlung auch tatsächlich zugetraut.Footnote 40
(5) Mit der nächstfolgenden Basileiaaussage in 19,12 wird die Erzähleinheit über Ehe, Ehebruch und Ehelosigkeit pointiert abgeschlossen. Nachdem Jesus sich in 19,2–9 mit den Pharisäern über Ehe und Ehebruch auseinandergesetzt und die Ermöglichung einer Scheidung mit der menschlichen Hartherzigkeit begründet hat (19,8), reagiert er in 19,11–12 auf eine resignierende Bemerkung seiner Jünger zur EhelosigkeitFootnote 41 und versucht, diesem negativen Verständnis ein positives entgegenzusetzen. Dazu konstatiert Jesus zum Auftakt,Footnote 42 dass nicht alle τὸν λόγον [τοῦτον], d.h. die in V. 12 folgende Basileiaaussage werden erfassen können, sondern nur die entsprechend Disponierten (οἷς δέδοται). Mit diesem Verweis auf eine Privilegierung zum Verstehen einer Aussage über das Himmelreich ist ein Bogen zurück zur Basileiaaussage in 13,11 geschlagen. Dort hat Jesus seinen Jüngern unter Verwendung derselben Terminologie wie in 19,11 (οἷς δέδοταιFootnote 43) attestiert, dass ihnen die Kenntnis der Geheimnisse des Himmelreiches gegeben ist.Footnote 44 Ist durch diesen erzählinternen Rückverweis auf die Basileiaaussage in 13,11 und den Ausblick auf die Basileiaaussage in 19,12 (τὸν λόγον τοῦτον) bereits in 19,11 ein ‚basileiatheologisches Klima’ geschaffen, hebt Jesus diese Thematik in 19,12 ausdrücklich ins Wort. Dabei benennt er mit dem Verweis auf die körperliche Verfassung und eine von außen kommende Fremdbestimmung zunächst jene beiden Gründe für Ehelosigkeit, welche nach alttestamentlichen Vorgaben einen Ausschluss aus der Gemeinde zu begründen vermögen (Dtn 23,2).Footnote 45 Dies dient ihm als Negativfolie für die Anführung seiner positiven Begründung der Ehelosigkeit διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Besonders im Licht der Präsentation der beiden Negativbeispiele fällt auf, dass beim Positivbeispiel der Aspekt der aktiven Wahl des Menschen betont wird (εὐνούχισαν ἑαυτούς) und im Zusammenspiel der Vv. 11–12 als Gegengewicht zu dem zunächst in V. 11 eingebrachten Gedanken einer von Gott kommenden Privilegierung zum Erfassen dieser Basileiaaussage erscheint (τὸν λόγον [τοῦτον] ἀλλ᾿ οἷς δέδοται). Durch dieses Austarieren von göttlichem und menschlichem HandlungsanteilFootnote 46 wird signalisiert, dass der entsprechend begabte MenschFootnote 47 sich selbst zur Ehelosigkeit zu entscheiden hat – und dazu wird er am Ende von V. 12 explizit aufgefordert (ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω) –, und zwar nicht aus Eigeninteresse, sondern im Blick auf die andringende Wirklichkeit des Himmelreiches (εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν). Damit erscheint das εὐνούχισαν ἑαυτούς als Möglichkeit einer sachgemäßen Lebensweise im Horizont des nahe herangekommenen Himmelreiches und als eine Konkretion der in 6,33 aufgestellten Forderung, der Basileia Gottes und dessen Gerechtigkeit im eigenen Leben absolute Priorität einzuräumen (πρῶτον).Footnote 48
(6) Die in 19,12 spürbare Ausrichtung auf den Aspekt der menschlichen Disposition für das Himmelreich setzt sich ungebrochen in der nächstfolgenden Basileiaaussage in 19,14 fort, mit welcher Jesus auf die Kinder abweisende Haltung seiner Jünger reagiert.Footnote 49 Seine Entscheidung, entgegen deren Votum die Kinder zu sich kommen zu lassen, begründet (γάρ) er mit Verweis darauf, dass solchen die Gottesherrschaft gehört (τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶνFootnote 50). Für die Annahme, dass mit diesem Zuspruch nicht ausschließlich den anwesenden Kindern, sondern darüber hinaus auch den diesen vergleichbar verfassten Menschen das Heil der Gottesherrschaft gegenwärtig-verbindlichFootnote 51 zugesagt wird, spricht die Verwendung des substantivierten Demonstrativpronomens οἱ τοιοῦτοι. Durch dessen Einsatz erhält die Basileiaaussage über ihren konkreten Bezugspunkt hinausFootnote 52 auch eine weiter gefasste exemplarische Dimension („solchen Menschen“), wobei die Haltung der Kinder als Orientierungsmaßstab für das Erlangen des Himmelreiches ausgewiesen wird. Von den Basileiaaussagen in 18,3–4 herFootnote 53 ist dabei konkret an die Befähigung zu denken, seine eigene Position ὡς τὰ παιδία ohne eigene Erhöhung angemessen einschätzen zu können und entsprechend zu handeln.
(7–8) Entscheidend zugespitzt wird die Betonung der menschlichen Verantwortung für das Gewinnen der Zutrittserlaubnis zum Himmelreich in den beiden Basileiaaussagen in 19,23–4, mit welchen Jesus nach dem traurigen Weggehen des reichen Jünglings anschaulich die Radikalität seines Nachfolgerufes vor Augen stellt. Ist dabei zunächst noch davon die Rede, dass es für einen Reichen schwerlich/mit Schwierigkeiten behaftet ist, ins Himmelreich zu gelangen (δυσκόλως εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν), so wird spätestens durch den Rückgriff auf das sich „ins Absurde“Footnote 54 bewegende Bild vom Kamel und dem Nadelöhr in V. 24 zu verstehen gegeben, dass es für einen Reichen nicht nur schwer, sondern aus eigener KraftFootnote 55 gänzlich unmöglich ist, in das Reich Gottes zu gelangen (εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ).Footnote 56
(9) Die nächste Basileiaaussage ist als königschristologische Verheißung gefasst, mit welcher Jesus in 19,28 den Jüngern, die im Unterschied zum reichen Jüngling alles aufgegeben haben, ein endzeitliches gemeinschaftliches Thronen zum Gericht über Israel in Aussicht stellt. Fortgeführt wird diese speziell den Jüngern gegebene Heilszusage durch eine Perspektivenweitung in 19,29, um allen Menschen in der Jesusnachfolge einen Lohn für den gegenwärtigen Verzicht um Jesu Namens willen (ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου) in Aussicht zu stellen, und zwar das HundertfacheFootnote 57 und das ewige Leben (ἑκατονταπλασίονα λήμψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον). Anders als in Mk 10,30, wo die Zusage des Hundertfachen eindeutig auf das Diesseits bezogen ist (νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ) und materialiter als Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker μετὰ διωγμῶνFootnote 58 spezifiziert wird, differenziert der matthäische Jesus nicht ausdrücklich zwischen einer diesseitig-gegenwärtigen und einer jenseitig-zukünftigen Perspektive. Durch die gegenüber Mk 10,30 wesentlich unbestimmter gehaltene Fassung der Versprechung des Hundertfachen entsteht in Verbindung mit der Verwendung der Futurform λήμψεταιFootnote 59 der Eindruck einer merklichen Fokussierung allein auf den jenseitig-künftigen Aspekt der Verheißung ewigen Lebens. Beachtet man diese matthäische Akzentuierung der Lohnaussage in 19,29 und sieht in dieser erzählinternen VorgabeFootnote 60 einen Ansatzpunkt zur Bestimmung des zeitlichen Blickwinkels, welcher im sich nahtlos anschließenden Himmelreichgleichnis mitsamt den rahmenden Rangumkehraussagen anvisiert ist (19,30–20,16), legt sich folgende Annahme nahe: Die in 20,8–10 präsentierte Lohnauszahlung weist gleichnishaft auf GottesFootnote 61 Vorgehen bei der endzeitlich-endgerichtlichen Zuteilung von Heil hin.Footnote 62
(10) Jenseits aller Diskussionen um die (ökonomische) Bewertung der Handlungsweise des WeinbergbesitzersFootnote 63 und um mögliche sozialethische Dimensionen des Gleichnisses schon bei MatthäusFootnote 64 gelangen die Analysen der Leserlenkung doch weitgehend übereinstimmend zu der Annahme, dass die ‚Faszination’ dieses Gleichnisses darin besteht, dass die kunstvoll in Mt 20,2–7 aufgebaute Erwartungshaltung, dass die Langzeitarbeiter einen anteilmäßig höheren Lohn für ihr Tagewerk erhalten, aufgrund der gewählten Auszahlungsweise in Mt 20,8–11 ebenso kunstvoll enttäuscht wird.Footnote 65 In diesem Moment absichtlich provozierter Enttäuschung flechtet der matthäische Jesus die Gerechtigkeitsthematik ein, wenn er den Weinbergbesitzer gegenüber den Langzeitarbeitern davon sprechen lässt, dass sie kein Unrecht erlitten haben (οὐκ ἀδικῶ σε). Nimmt man ferner noch die Selbstcharakterisierung des Weinbergbesitzers als ἀγαθός am Gleichnisende hinzu, wird man Zeuge, wie Jesus seine Gesprächsadressaten im Spannungsfeld der Bezugnahme auf die Facetten von Gerechtigkeit und Gutsein mit der folgenden theologischen Grundüberzeugung konfrontiert: Gottes GerechtigkeitFootnote 66 durchkreuzt irdische Gerechtigkeitsmaßstäbe wie die Erwartung, eine an der Einsatzlänge orientierte Ausgleichsleistung beanspruchen zu können, radikal.Footnote 67
(11 als Ergänzung) Diente die basileiachristologische Aussage in 19,28 noch als verheißungsvoller Ausblick auf die endzeitliche Situation der Jünger in ihrer Throngemeinschaft mit Christus, spiegelt sich in der hier ergänzend einzubeziehenden Basileiaaussage in 20,21 ein Missverständnis bezüglich der Modalitäten der Herrschaftsausübung Jesu und des Zeitpunkt des gemeinsamen Thronens wider. Während hinter der Bitte der Zebedaidenmutter die Erwartung steht, dass Jesus bereits unmittelbar nach seiner Einsetzung als König, d.h. nach seiner Erhöhung thronen werde, macht Matthäus im Laufe seiner Erzählung deutlich (Mt 28,17–20), dass sich die königliche Amtsausübung Jesu bis zur Parusie nicht durch ein Thronen zum Gericht, sondern durch das Recht zur universalen Aussendung seiner Jünger auszeichnet. Im Unterschied zu dieser Aussendungsvollmacht kommt Jesus nach eigenem Bekunden die Vergabe endzeitlicher Ehrenplätze überhaupt nicht zu und bleibt allein Gott vorbehalten. Mit diesem Verweis auf die göttliche Vorrangstellung wird der Gedanke der nur Gott selbst zukommenden allumfassenden Handlungshoheit betont. Damit wird die im Himmelreichgleichnis in 20,1–16 über die Skizzierung der Vorgehensweise des Weinbergbesitzers eingebrachte Facette, dass Gott frei über die Zuteilung von Heil entscheidet, explizit fortgeschrieben.
Zieht man an dieser Stelle ein kurzes Zwischenfazit, bleibt festzuhalten: Der Mensch wird in dem hier näher betrachteten Abschnitt der matthäischen Basileialinie mit einer sich steigernden Dynamik nachdrücklich in die Pflicht genommen,Footnote 68 seinen Beitrag zur Erlangung des ewigen Heils durch ein Leben nach den Maßgaben der Tora in ihrer von Jesus gebotenen Auslegung zu leisten. Als theologisches Gegengewicht zu dieser Verpflichtung hält Jesus in Mt 19,26, 20,15 und 20,23 in Erinnerung, dass die göttliche Freiheit zum Schenken des Heils von dieser Rückbindung an die menschliche Verantwortung unberührt bleibt.
3. Die Basileiaaussagen in Mt 19,16–20,16 im Fokus
Die am Ende von Abschnitt 2 angerissenen Beobachtungen zum göttlichen Handlungsanteil für das Erreichen des endzeitlichen Heils in diesem insgesamt doch stark auf die Betonung der menschlichen Verantwortung abzielenden Basileia-Linienabschnittes gewinnen noch an Substanz, wenn man die inhaltlich-strategische Zuordnung der Basileiaaussagen in der iii. Erzähleinheit in 19,16–20,16 detailliert bestimmt. Fragt man dazu nach der thematisch-pragmatischen Ausgestaltung dieser Einheit, lassen die Verse aufbauend auf der Grundlegung zum Erreichen eines bleibenden Schatzes im Himmel in Mt 19,16–21Footnote 69 eine diptychonartige Anlage mit zwei ungleich umfangreichen Bildhälften in Mt 19,22–6 bzw. Mt 19,27–20,16Footnote 70 erkennen. Dabei basiert die Ausgestaltung beider Hälften auf der Überzeugung, dass die jeweils in den Blick kommende eigene Entscheidung zum Nichteintritt bzw. Eintritt in die Jesusnachfolge vorläufigen Charakter hat und bis zum Lebensende oder ggf. zum Zeitpunkt der Parusie JesuFootnote 71 zum PositivenFootnote 72 bzw. NegativenFootnote 73 verändert werden kann. Auf dem Hintergrund dieser Grundannahme wird die Nachfolgethematik in 19,16–26 und 19,27–20,16 unter den beiden Extrempositionen von vorläufig gescheiterter und vorläufig erfolgreicher Nachfolge durchbuchstabiert und die Situation des reichen Jünglings und der Jünger Jesu unter soteriologisch-eschatologischer Perspektive betrachtet (Tabelle 2).
Tabelle 2. Mt 19,16–20,16 als Diptychon.
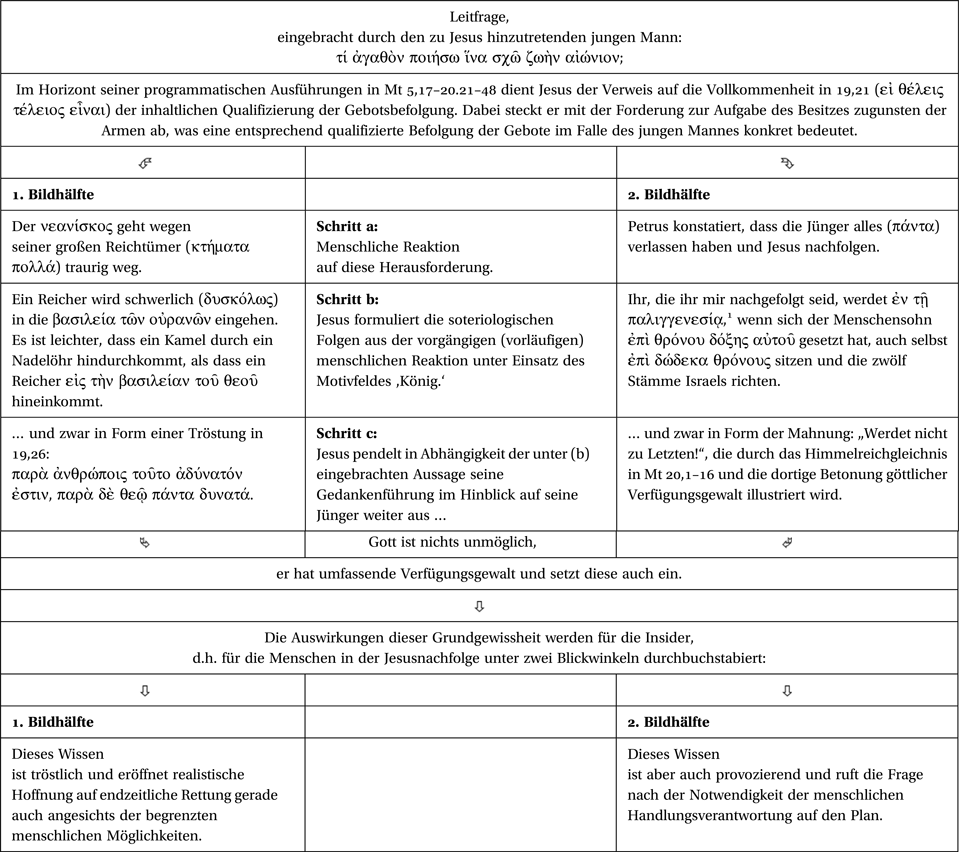
1 Einen Überblick über die Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten von παλιγγενεσία bietet z.B. J. Dey, ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ: Ein Beitrag zur Klärung der religionsgeschichtlichen Bedeutung von Tit 3,5 (NTA 17,5; Münster: Aschendorff, 1937) 3–35; zur Bedeutung in Mt 19,28 siehe M. Konradt, „‚Ihr wisst nicht, was ihr erbittet‘ (Mt 20,22): Die Zebedaidenbitte in Mt 20,20f und die königliche Messianologie im Matthäusevangelium (bisher unveröffentlicht)“, Studien zum Matthäusevangelium, 171–200, hier 191–2.
Folgt man diesem Vorschlag zur Strukturierung von Mt 19,16–20,16, ist zu erkennen, dass am Ende der jeweiligen Bildhälfte der Gedanke der unbegrenzten göttlichen Möglichkeiten zwar in sehr unterschiedlichem Umfang, aber doch in beiden Fällen vergleichbar nachdrücklich akzentuiert wird. So kontrastiert Jesus auf der ersten Bildhälfte im Anschluss an die erschrocken-besorgte Nachfrage seiner Jünger, τίς ἄρα δύναται σωθῆναι, mit welcher diese auf die beiden Basileiaaussagen in 19,23–24 reagieren, dem menschlichen Unvermögen die allumfassende Handlungsmacht Gottes (παρὰ θεῷ πάντα δυνατά). Gott ist uneingeschränkt in der Lage, auch dort noch Zutritt zu seinem Heils- und Herrschaftsbereich zu ermöglichen, wo es aus menschlicher Perspektive völlig ausweglos ist (παρὰ ἀνθρώποις ἀδύνατον). Mit dem Einbringen dieses Gedankens soll im Umkehrschluss nicht die entscheidende Rolle des Menschen für die Erlangung der Zutrittsberechtigung zur himmlischen Basileia infrage gestellt werden,Footnote 74 wohl aber wird gerade in Anbetracht der anthropozentrisch orientierten Ausgangsfrage des Jünglings (ποιήσω), in Erinnerung gehalten, dass der letztendlich entscheidende Akteur Gott allein ist.Footnote 75 Im festen Vertrauen auf dessen uneingeschränkte Handlungshoheit und dessen HeilswillenFootnote 76 dürfen die Menschen in der Jesusnachfolge auf Gottes Hilfe hoffen und so zuversichtlich versuchen, durch das Tun des Mehr an Gerechtigkeit eben jenes Kriterium der Vollkommenheit zu erfüllen, welches Jesus in 19,21 als Bedingung für das Erhalten des Schatzes im Himmel ausgewiesen hat.Footnote 77
Das Theologoumenon von der göttlichen All-Möglichkeit, welches im Zusammenhang mit den vorangehenden radikalen Aussagen über die Nicht-Zutrittsmöglichkeiten für Reiche zum Himmelreich als Entlastung und Tröstung, nicht aber als Relativierung der menschlichen Verantwortung erscheint, verändert seinen Charakter bzw. kann dies in der Wahrnehmung der Jünger tun, wenn es aus einer anderen Perspektive angeschaut wird. Betrachtet man diese heilvolle theologische Aussage nämlich aus dem Blickwinkel der immensen Verzichtsleistung der Jünger in der Jesusnachfolge, von welcher Petrus in 19,27 ausdrücklich spricht, kann der Eindruck eines ungerecht handelnden Gottes entstehen. Vom unmittelbar vorausgehenden Dialog steht ja der Gedanke im Raum, dass Gott letztendlich auch bei menschlichem (Teil-)VersagenFootnote 78 noch alles zum Guten führen und ewiges Heil schenken kann. Diese Herausforderung für die menschliche Gerechtigkeitsvorstellung wird in 19,27–20,16 durchbuchstabiert, allerdings anders als noch auf der ersten Bildhälfte nicht mehr unter der Grundfrage des Erlangens bzw. Verfehlens des ewigen Heils, sondern unter der soteriologisch nachgeordneten Frage nach einer besonderen Stellung bzw. Auszeichnung innerhalb des göttlichen Heilsbereichs. Die Fokussierung der Gleichniserzählung in Mt 20,1–15 auf den Aspekt der Vorrangstellung, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Umkehrung der Reihenfolge, wird durch die beiden Rahmennotizen in Mt 19,30.20,16 erreicht. Dadurch ist ein Nebenzug der ursprünglichen Dynamik der Erzählung betont ins Zentrum gerückt. Durch die so erzielte inhaltliche Ausrichtung der Weinbergerzählung ist sie argumentationsstrategisch dazu geeignet, den Jüngern Folgendes vor Augen zu führen: Aufgrund ihres unbestreitbar großen Einsatzes in der Jesusnachfolge und damit auch für die irdische Gestaltwerdung der göttlichen Basileia können sie Gefahr laufen, (a) aus ihrem immensen Engagement einen Anspruch auf eine privilegierte Stellung im ewigen Leben erheben zu wollen bzw. (b) Menschen, denen bei vergleichsweise geringerem Engagement ebenfalls ewiges Heil zuteil wird, zu beneiden (ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός ἐστιν). Mit der in Gleichnisform anschaulich vorgestellten Warnung vor dieser Gefährdung hält Jesus grundlegend in Erinnerung, dass bei allem notwendigen menschlichen Beitrag die Zuteilung von ‚Ehrenplätzen’ gnadenhaftes Geschenk der heilvollen göttlichen Zuwendung ist. Gott allein kommen aufgrund seines Gottseins unbegrenzte Möglichkeiten zu,Footnote 79 und Jesus deutet in seiner Zusage in Mt 19,17 an, dass die Jünger diese gnadenhafte Geschenk erhalten werden, aber ohne dass es von menschlicher Seite aus beansprucht werden könnte.
Darüber hinaus fungiert das Gleichnis als Entlastung, durch dessen Erzählen Jesus deutlich macht, dass es zur Wirklichkeit des Himmelreiches und der Teilhabemöglichkeit an diesem gehört, dass es keiner Höchstleistungen bedarf. Es ist die Güte Gottes selbst (ἐγὼ ἀγαθός εἰμι), die „diejenigen, die keine religiösen Leistungen vorzuzeigen haben, vorbehaltlos in Dienst nimmt, ihnen bedingungslos das zum Leben und zum Heil Notwendige schenkt“.Footnote 80 Bei der Veranschaulichung dieses Gedankens, der für die Menschen in der Nachfolge mit ihren Verzichtsleistungen ihre Vorstellung von Gerechtigkeit herausfordern kann, verzichtet Jesus durch die offene Ausgestaltung des Gleichnisendes auf jede PolemikFootnote 81 und versucht dadurch das Einverständnis dieses Personenkreises zu erzielen. Ohne deren Leistung zu relativieren oder für überflüssig zu erklären, sollen die Menschen in der Jesusnachfolge zu der Einsicht geführt werden, dass sie ihren Beitrag zu erbringen haben, ohne daraus Ansprüche auf Privilegierung ableiten zu können. Sie sollen verstehen, dass Gottes Güte seine Gerechtigkeit nicht infrage stellt, sondern dass diese Güte sein Gerechtigkeitsverständnis und seine Herrschaft wegweisend bestimmt.
Dadurch dass Gott im Zuge der erzählerischen Entfaltung der Basileiathematik betont als schenkend und gütig gezeichnet wird und zugleich in der Auftakterzähleinheit des hier fokussierten Erzählausschnittes in 17,25 die geläufige Praxis irdischer Könige zur Steuer- und Abgabenerhebung Erwähnung findet (οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσιν τέλη ἢ κῆνσον),Footnote 82 ist ein eklatanter Unterschied zwischen irdischer und himmlischer Herrschaftsausübung angedeutet: Während die irdischen Könige Abgaben und Steuern verlangenFootnote 83 und darin ihren Herrschaftsanspruch zur Geltung bringen, erweist Gott seine königliche Herrschaft völlig gegenteilig durch Beschenken und das Gewähren von Güte.Footnote 84
4. Fazit – Ein provozierendes Theologoumenon: Gott ist alles möglich
Der gezielte Blick auf die erzählerische Entfaltung der matthäischen Basileiakonzeption in Mt 17,24–20,16 hat einen tragfähigen Eindruck davon vermittelt, wie präzise und mehrschichtig der matthäische Jesus zwischen den beiden maßgeblichen Komponenten von göttlicher Vollmacht und menschlicher Verantwortung für das Erlangen des Himmelreiches abwägt. Dabei wird der Mensch auf einer ersten Ebene in diesem Linienabschnitt mit einer sich steigernden Dynamik nachdrücklich in die Pflicht genommen,Footnote 85 seinen Beitrag durch ein Leben nach den Maßgaben der Tora in ihrer von Jesus gebotenen Auslegung zu leisten und so das in 5,20 programmatisch geforderte Mehr an Gerechtigkeit tatsächlich einzubringen. Unter machtstrukturellem-innergemeindlichem Betrachtungswinkel wird dieses Mehr in den durch die Basileiaaussage der Mutter der Zebedaiden angestoßenen Ausführungen Jesu in Mt 20,27–8 noch weiter konkretisiert und an das Vorbild Jesu zurückgebunden. Dabei macht dieser deutlich, dass jegliche Form seiner Herrschaftsausübung und davon abgeleitet auch die seiner Jünger unter der Prämisse des Dienens steht.Footnote 86 So soll die Vorrangstellung der Jünger in ihrem gemeindlichen Zusammenleben im Unterschied zur Herrschaftspraxis der irdischen Machthaber im Dienen und Sklave-Sein Gestalt gewinnen (Mt 20,26–7), womit sie das Beispiel Jesu und seiner bedingungslosen Lebenshingabe zugunsten der Vielen mutatis mutandis nachahmen (Mt 20,28Footnote 87).
Mit der Fokussierung auf den Aspekt der Unverzichtbarkeit der menschlichen Komponente und dem nachdrücklichen Appell zu einer dienenden, am Beispiel Jesu orientierten innergemeindlichen Herrschaftsausübung fügt sich der Bildausschnitt in Mt 17–20 passgenau in die übergreifende Basileialinienführung der Gesamterzählung ein,Footnote 88 wobei der matthäische Jesus als Kontergewicht auf einer weiteren Ebene in Mt 19,26 und Mt 20,15 festhält, dass die göttliche Freiheit zum Schenken des Heils von dieser Rückbindung an die menschliche Verantwortung unberührt bleibt. Diese Spannung zwischen der Betonung der Unverzichtbarkeit des menschlichen Beitrags einerseits und der Wahrung der göttlichen Freiheit andererseits wird erzählerisch aber nicht vollends aufgelöst, sondern als solche wahrgenommenFootnote 89 und von verschiedenen Seiten näher ausgeleuchtet. Und genau in diesem Bereich erfüllt das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg eine ganz entscheidende Funktion: Es deckt den provozierenden Gehalt des Theologoumenons von den unbegrenzten göttlichen Möglichkeiten anschaulich auf. Dieser zeigt sich besonders scharf unter dem Blickwinkel von Gottes Gerechtigkeit und dem (davon zu unterscheidenden) Gerechtigkeitsverständnis der Jünger und ihrer immensen eigenen Verzichtsleistung. Während bei der Beschäftigung mit der Grundsatzfrage nach dem Gewinnen bzw. Nichtgewinnen des ewigen Lebens die Spannung zwischen den Facetten der göttlichen Möglichkeiten und der menschlichen Verantwortung unaufgelöst stehen bleibt, wird sie im Himmelreichgleichnis in 20,1–15 und anschließend auch in 20,23 im nachgeordneten Bereich der Gewährung von ‚himmlischen Privilegien’ zugunsten der Akzentuierung des Vorrangs der göttlichen Handlungsfreiheit aufgelöst. Die Jünger sollen zu der Einsicht gelangen, dass aus dem Tun des Mehr an Gerechtigkeit kein Anspruch auf ewiges Heil in Form des Eintritts ins Himmelreich erwächstFootnote 90 und dass eine dortige Privilegierung nicht durch menschliche Ausdauerleistung erzwungen werden kann, sondern Gottes freie Gabe ist. Damit dadurch im Umkehrschluss aber nicht der Eindruck entsteht, dass die immense Verzichtsleistung der Jünger eigentlich überflüssig sei, hilft Jesus die Differenzierung zwischen der Grundebene, auf welcher es generell um die Erlangung des Heils geht (Fokus in 19,16.29), und dem dazu nachgeordneten Bereich der Gewährung von Privilegien im Himmelreich (Fokus in 19,28) strategisch weiter, die beiden Facetten von menschlichem und göttlichem Handlungsanteil auf mehreren Ebenen differenziert in Beziehung setzen zu können. Dabei fällt von der spürbaren Betonung des Vorrangs der göttlichen Handlung im nachgeordneten Bereich der Vergabe von ‚Ehrenplätzen’ (20,23) insofern auch Licht auf die Grundebene, als auch auf dieser gilt, dass die Heilsgewährung göttliches Geschenk bleibt. Im Hoffen auf dieses Geschenk und im Vertrauen auf Gottes Heilswillen hat der Mensch in der Jesusnachfolge ein gottgefälliges Leben nach den Maßgaben der von Jesus authentisch ausgelegten Tora zu führen und sich so für den Eintritt ins Himmelreich zu qualifizieren, eingedenk der Tatsache, dass aus dieser Lebensführung kein Anspruch auf Heil erwächst.




